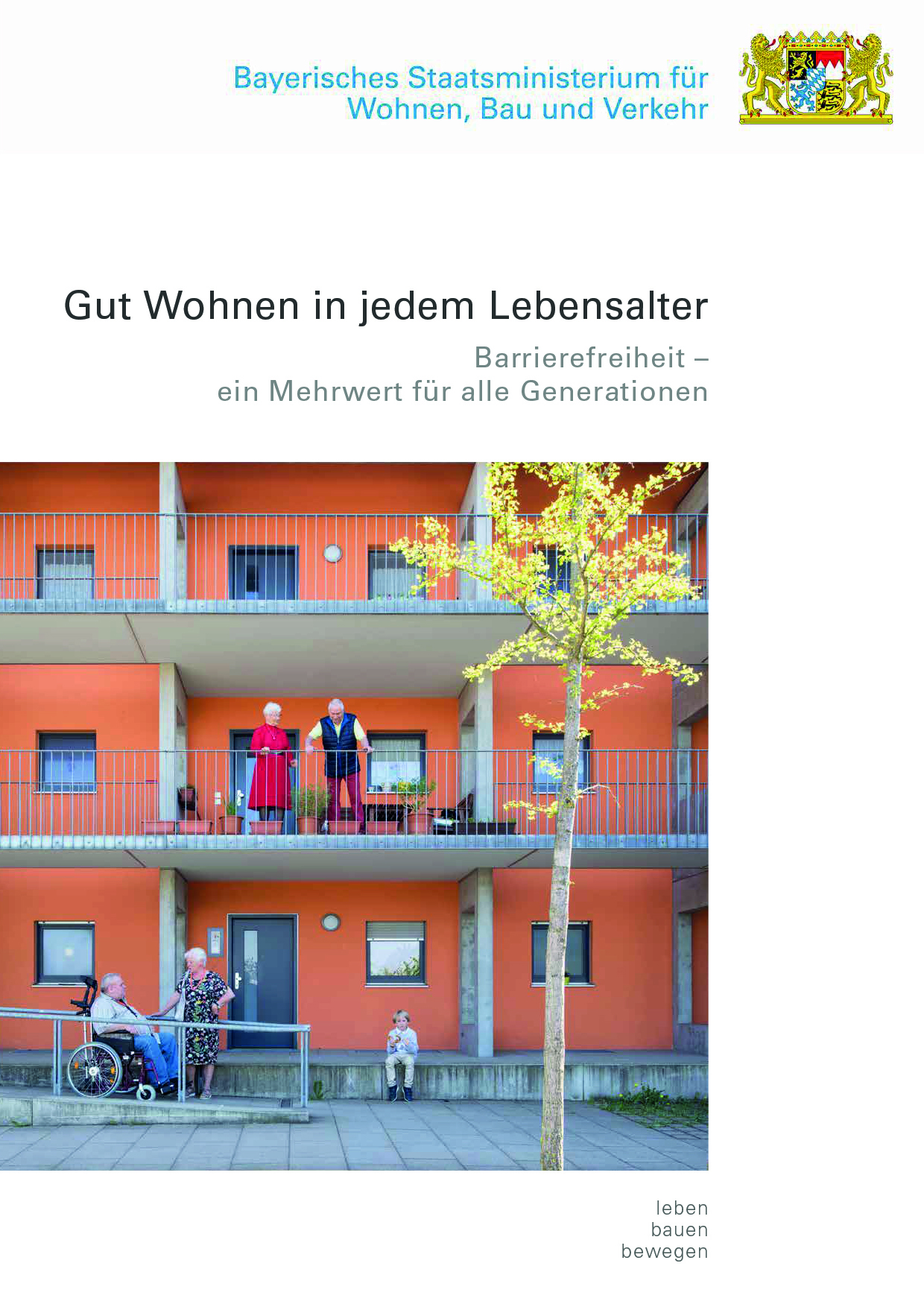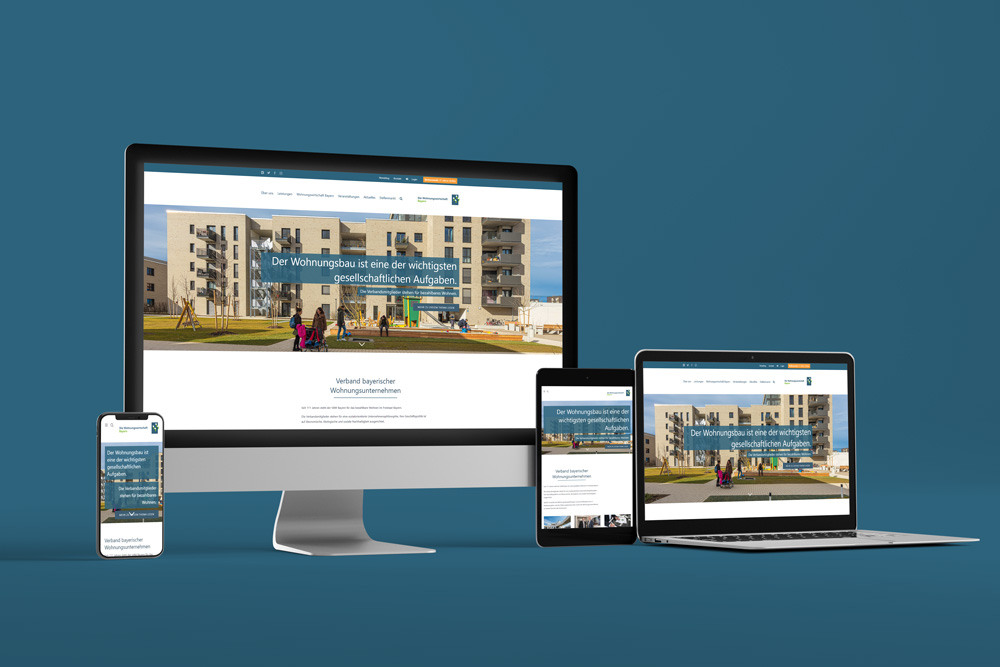Der Landtag hat am 2.12.2020 eine umfassende Reform der Landesbauordnung (BayBO) beschlossen. Vorrausgegangen waren Umfragen unter den Verbänden der Wohnungswirtschaft, der Bauwirtschaft, den kommunalen Spitzenverbänden sowie eine
Expertenanhörung am 22.10.2020. Das nun beschlossene Änderungsgesetz soll am 1.2.2021 in Kraft treten und die Voraussetzungen für einfacheres und schnelleres, aber auch für nachhaltiges, flächensparendes und kostengünstiges Bauen schaffen.
So wird die weitere Vereinheitlichung der materiell bauordnungsrechtlichen Anforderungen vorgenommen: Sie werden beim Abstandsflächenrecht an die bereits in zahlreichen Bundesländern geltende Musterbauordnung angepasst.
Das Abstandsflächenrecht wird deutlich vereinfacht. Die Abstandsflächen werden auf 40% der Wandhöhe (H) reduziert. Zugleich bleibt die Tiefe der Mindestabstandsfläche mit 3 Meter (m) unverändert. Damit wird grundsätzlich das 16 m Privileg ersetzt. Allerdings können Gemeinden abweichende Regelungen für ihr Gemeindegebiet beschließen, sofern städtebauliche oder ortstypische Aspekte ein Abweichen von der Regeltiefe erfordern. Die schon bisher gültige Verkürzung der Abstandsflächentiefe auf 0.5 H in Kerngebieten und urbanen Gebieten entfällt zugunsten der neuen allgemeinen Verkürzung auf 0.4 H. Damit soll der Flächenverbrauch – bei einer noch verträglichen Dichte – deutlich reduziert werden. In den großen drei bayerischen Städten mit mehr als 250.000 Einwohnern München, Nürnberg und Augsburg kann die bisherige Abstandsflächenregelung inkl. 16 m Privileg beibehalten werden, um sowohl Nachverdichtung zu ermöglichen als auch vorhandene Bestandsstrukturen zu erhalten und maßvoll weiterzuentwickeln.
Verfahrenspflichten werden künftig auf die Fälle konzentriert, in denen eine präventive Prüfung unbedingt notwendig ist. Deshalb wird der Dachgeschossausbau innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen nach § 34 Abs. 1 BauGB genehmigungsfrei gestellt – ein wichtiger Aspekt, um schneller zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Mit der Typengenehmigung durch das Bayerische Bauministerium wird – auch für den Wohnungsbau – das serielle Bauen gestärkt. Sie wirkt wie ein baurechtlicher Nachweis und ist für fünf Jahre gültig. Dieser Zeitraum kann um weitere fünf Jahre verlängert werden.
Eine verfahrensbeschleunigende Wirkung soll die im vereinfachten Genehmigungsverfahren für Wohnungsbauvorhaben geltende Genehmigungsfiktion haben. Ein vollständig eingereichter Bauantrag soll künftig als genehmigt gelten, wenn die Baubehörde nicht innerhalb von drei Monaten über ihn entscheidet. Eine wesentliche Verantwortung liegt allerdings weiterhin beim Bauherrn. Er muss einen vollständigen Bauantrag einreichen. Danach hat die Genehmigungsbehörde drei Wochen Zeit, um die Vollständigkeit der Unterlagen festzustellen.
Wenn das der Fall ist, beginnt die dreimonatige Fiktionsfrist. Diese Frist kann seitens der Genehmigungsbehörde einmal verlängert werden, wenn dies wegen der Schwierigkeiten im Einzelfall gerechtfertigt ist. Die Genehmigungsfiktion entfaltet auch ohne Bescheid die gleiche Wirkung wie eine ordnungsgemäß zustande gekommene und bekannt gemachte Baugenehmigung.
Eine weitere wesentliche Änderung sieht vor, dass der Baustoff Holz in allen Gebäudeklassen verwendet werden kann. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes soll die Holzbaurichtlinie als technische Baubestimmung bekannt gemacht werden. Regeldetails können z.B. unter teilweisem Verzicht auf eine brandschutztechnische Bekleidung Holz als konstruktives Element sichtbar lassen. Anstelle der für Gebäude der Gebäudeklassen 4 und 5 vorgeschriebenen Außenwandbekleidungen aus schwer entflammbaren Baustoffen werden auch normal entflammbare Baustoffe zugelassen, wenn sie den Anforderungen der Holzbaurichtlinie entsprechen, die geeignete technische Lösungen zur Brandweiterleitung über die Außenwandbekleidung vorgibt. D.h.: Bei einer geeigneten Dämmung kann Holz auch als sichtbarer Baustoff im Geschosswohnungsbau für die Fassade verwendet werden. Nachhaltiger Wohnungsbau mit Holz wird so deutlich attraktiver und vor allem einfacher.
Wesentliche Erleichterungen in der Bestandsentwicklung
Die Pflicht zum nachträglichen Einbau eines Aufzugs wird aufgehoben, wenn bei Aufstockungen zur Schaffung von Wohnraum ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. Von der Ausnahme sind sowohl die Fälle erfasst, bei denen eine Erhöhung des Gebäudes eine erstmalige Aufzugspflicht begründet, als auch Fälle, bei denen ein bestehender Aufzug lediglich in die neuen Geschosse hochgeführt werden müsste.
Ebenso sollen künftig vorhandene rechtskräftige Abweichungen eines Bestandsgebäudes im Hinblick auf Abstandsflächen, Brandschutzabstände, Feuerwiderstandsdauer von Konstruktion, Decken und Dächern einer Nutzungsänderung zu Wohnzwecken nicht entgegenstehen, wenn die bisherige Nutzung bereits Aufenthaltszwecken (z.B.: Büros) diente.
Noch wichtiger für die Wohnungswirtschaft ist die Ergänzung im Artikel 63, die Abweichungen von den Abstandsflächen vorsieht, wenn ein rechtmäßig errichtetes Gebäude durch ein Wohngebäude höchstens gleicher Abmessung und Gestalt ersetzt wird.
Damit wird der in vielen Situationen sinnvolle Ersatzneubau gestärkt.
Ein vermeintlich unwesentliches Thema, das aber häufig zu sehr unbefriedigenden und vielfach kümmerlichen Ergebnissen führt, ist die Spielplatzpflicht. Das aus dem Stellplatzrecht bekannte Modell wird nun umfassend auf die Pflicht zum Spielplatznachweis übertragen. Die Spielplatzpflicht kann künftig auf dreierlei Weise erfüllt werden: durch Nachweis des Spielplatzes auf dem Baugrundstück, durch Nachweis auf einem in der Nähe gelegenen geeigneten Grundstück oder durch Spielplatzablöse. Letztere schafft die Möglichkeit, dass statt mehrerer kleiner Spielplätze in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang ein größerer zentraler Spielplatz durch die Gemeinde hergestellt wird.
Nicht nur eine Randnotiz wert ist die Neufassung des Art.81. In Anlehnung an den Wortlaut des zweiten Gesetzes zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern, der es Gemeinden ermöglicht, die Begrünung von Gebäuden insgesamt – nicht nur wie bisher für Dächer, sondern auch für Fassaden – durch Satzung festzulegen. Damit soll der Klimaschutz verbessert und insbesondere der sommerlichen Hitzeentwicklung in Wohnquartieren entgegengewirkt werden.
Erfreulicherweise wird durch 15 Pilotprojekte die längst überfällige Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren angegangen. Es bleibt abzuwarten, wie lange es dauern wird, bis alle Genehmigungsbehörden so ausgestattet sind, dass die Verfahren tatsächlich komplett papierlos gestaltet werden können.
Fazit
Der VdW Bayern hält den eingeschlagenen Weg bei den bayerischen Bauverordnungen für dringend erforderlich und begrüßt die Novelle. Viele der nun beschlossenen Maßnahmen und Änderungen entsprechen den langjährigen Forderungen der bayerischen Wohnungswirtschaft.