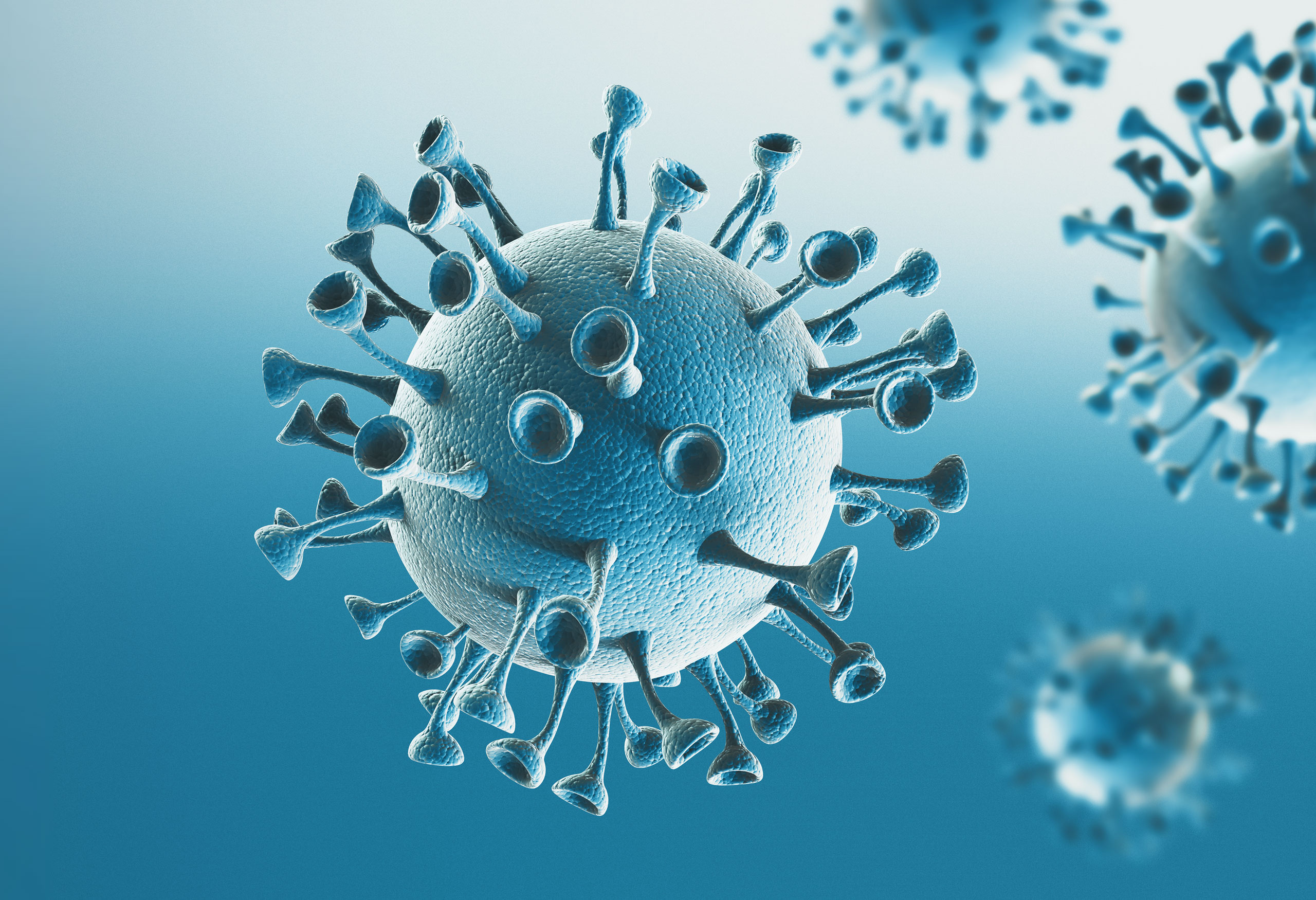Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dem Bundeskabinett am 20.01.2021 verschärfende Maßnahmen der „Corona-Arbeitsschutzverordnung” vorgelegt. Die Maßnahmen dienen sowohl der Kontaktreduktion im Betrieb als auch einer besseren Möglichkeit der Nachverfolgung bei einer Infektion. Der zuständige Bundesarbeitsminister hat die Verordnung bereits unterzeichnet, so dass die Verordnung am 27.01.2021 in Kraft treten wird.
Im Einzelnen:
1. Maßnahmen zur Kontaktreduktion im Betrieb
1.1 Anpassung betrieblicher Infektionsschutzmaßnahmen
Gemäß § 2 Abs. 1 der Verordnung hat der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes zu überprüfen und zu aktualisieren.
Empfehlung:
Die bereits erfolgten Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes sind zu überprüfen und entsprechend der Verordnung zu aktualisieren. Neben der Umsetzung der Vorgaben wird die Dokumentation über die Umsetzung der verschärften Vorgaben dringend empfohlen.
1.2 Vorrang von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Vermeidung von Kontakten
Gemäß § 2 Abs. 2 hat der Arbeitgeber alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren.
Empfehlung:
Die Vorschrift enthält einen Hinweis auf den Vorrang von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Kontaktvermeidung. Insofern ist zu prüfen, inwieweit durch organisatorische oder technische Maßnahmen persönliche Kontakte vermieden werden. Lässt sich Anwesenheit im Betrieb nicht verhindern, sind die weiteren Regelungen zur Kontaktvermeidung zu beachten.
1.3 Betriebsbedingte Zusammenkünfte
§ 2 Abs. 3 bestimmt, dass betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen auf das betriebsnotwendige Minimum zu
reduzieren und nach Möglichkeit durch die Verwendung von Informationstechnologie zu ersetzen sind. Können solche betriebsnotwendigen Zusammenkünfte nicht durch Informationstechnologie ersetzt werden, hat der Arbeitgeber durch andere geeignete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der Beschäftigten sicherstellen, insbesondere durch Belüftungsmaßnahmen und geeignete Abtrennungen zwischen den anwesenden Personen.
Empfehlung:
Die Vorschrift entfaltet eine Bindungswirkung. Im Kern bedeutet die Vorschrift, dass betriebsbedingte Zusammenkünfte auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren sind. Andernfalls sind für den Ausnahmefall die in § 2 Ab. 3 Satz 2 aufgezeigten Maßnahmen zu treffen.
1.4 „Homeoffice”
Gemäß § 2 Abs. 4 hat der Arbeitgeber den Beschäftigten im Falle von Büroarbeit oder vergleichbarer Arbeit anzubieten, diese Tätigkeit in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.
Empfehlung:
Büroarbeiten oder vergleichbare Tätigkeiten sind vorrangig in der Wohnung des Beschäftigten auszuführen. Eine Unterscheidung zwischen Homeoffice oder mobilem Arbeiten wird in der Verordnung nicht vorgenommen. Es geht insgesamt um das Arbeiten in der Wohnung des Beschäftigten (allgemein „Homeoffice”). Die Vorschrift enthält zwar keine Pflicht zum „Homeoffice”. Der Arbeitgeber hat aber bei Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten dem Beschäftigtem das Arbeiten in der Wohnung anzubieten. Allein bei zwingenden betrieblichen Gründen kann hiervon abgesehen werden.
Auch wenn die Vorschrift keine Pflicht zum „Homeoffice” vorschreibt, so ist die Verordnung insbesondere im Zusammenspiel mit den anderen hier dargestellten Vorschriften doch als deutlicher Hinweis zu verstehen, dass “Homeoffice” die Regel sein sollte. Verstärkt wird der dringende Appell dahingehend, dass die zur Überwachung der Verordnung zuständige Behörde vom Arbeitgeber oder von den verantwortlichen Personen die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte und die Überlassung von entsprechenden Unterlagen verlangen kann.
Für die Umsetzung ist erforderlich, dass die räumlichen und technischen Voraussetzungen in der Wohnung der Beschäftigten gegeben sind.
1.5 Raumnutzung
§ 2 Abs. 5 bestimmt, dass soweit die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen erforderlich ist, eine Mindestfläche von 10 m2 für jede im Raum befindliche Person nicht unterschritten werden darf, soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen.
Empfehlung:
Die Regelung betrifft vor allem Gemeinschaftsräume oder Aufenthaltsräume, in denen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten oder sich in den Pausen oder zum Mittagessen treffen. Die Verordnung nennt allgemein „Räume”.
1.6 Gruppeneinteilung
§ 2 Abs. 6 bestimmt, dass in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten diese in möglichst kleine Arbeitsgruppen einzuteilen sind. Personenkontakte zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen im Betriebsablauf sowie Änderungen dieser Einteilung sind auf das betriebsnotwendige Minimum zu reduzieren. Ein zeitversetztes Arbeiten ist zu ermöglichen, soweit die betrieblichen Gegebenheiten dies zulassen.
Empfehlung:
Hintergrund der Regelung ist die Vermeidung betriebsbedingter Personenkontakte und eine schnelle Kontaktnachverfolgung in Betrieben. Die Bildung von festen Arbeitsgruppen wird ab einer Beschäftigungsanzahl von zehn Beschäftigten verpflichtend. Eine Änderung der Zusammensetzung dieser Gruppen ist – nach der Begründung des Entwurfs – nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Bestimmung zum zeitversetzten Arbeiten dient der weiteren Reduzierung von Personenkontakten im Betriebsablauf, insbesondere durch zeitliche Entzerrung bei der Nutzung von Kantinen, Pausenräumen, Umkleideräumen sowie der Vermeidung von Warteschlangen bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende.
Die Einteilung in Personengruppen betrifft Beschäftigte, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Um eine „Überkreuzung” mit den jeweiligen Personengruppen zu vermeiden, sollten bei Möglichkeit auch „Nichtbeschäftigte”, die in keinem Angestelltenverhältnis stehen, von dieser Gruppeneinteilung entsprechend der Intention der Verordnung erfasst sein. Ein flexibles Betreten der Büroräume ist – sofern von der Verordnung gedeckt – entsprechend Sinn und Zweck der Vorschrift nur innerhalb der Personengruppe möglich.
2. Mund-Nasen-Schutz
Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung hat der Arbeitgeber medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder die in der Anlage bezeichneten vergleichbaren Atemschutzmasken zur Verfügung zu stellen, wenn:
– Die Anforderungen an die Raumbelegung nach § 2 nicht eingehalten werden können oder
– wenn der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann oder
– wenn bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu rechnen ist.
Die Beschäftigten haben die vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellenden Masken zu tragen. Abs. 3 bestimmt weiter, dass der
Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnahmen treffen kann.
3. Inkrafttreten
Die Verordnung tritt am fünften Tag der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft; sie tritt am 15.03.2021 außer Kraft.
Ein ausführliches Rundschreiben finden Sie im Mitgliederbereich der VdW Bayern-Website unter Downloads/GdW-Rundschreiben.
Wir werden Sie weiterhin über das Thema informieren.