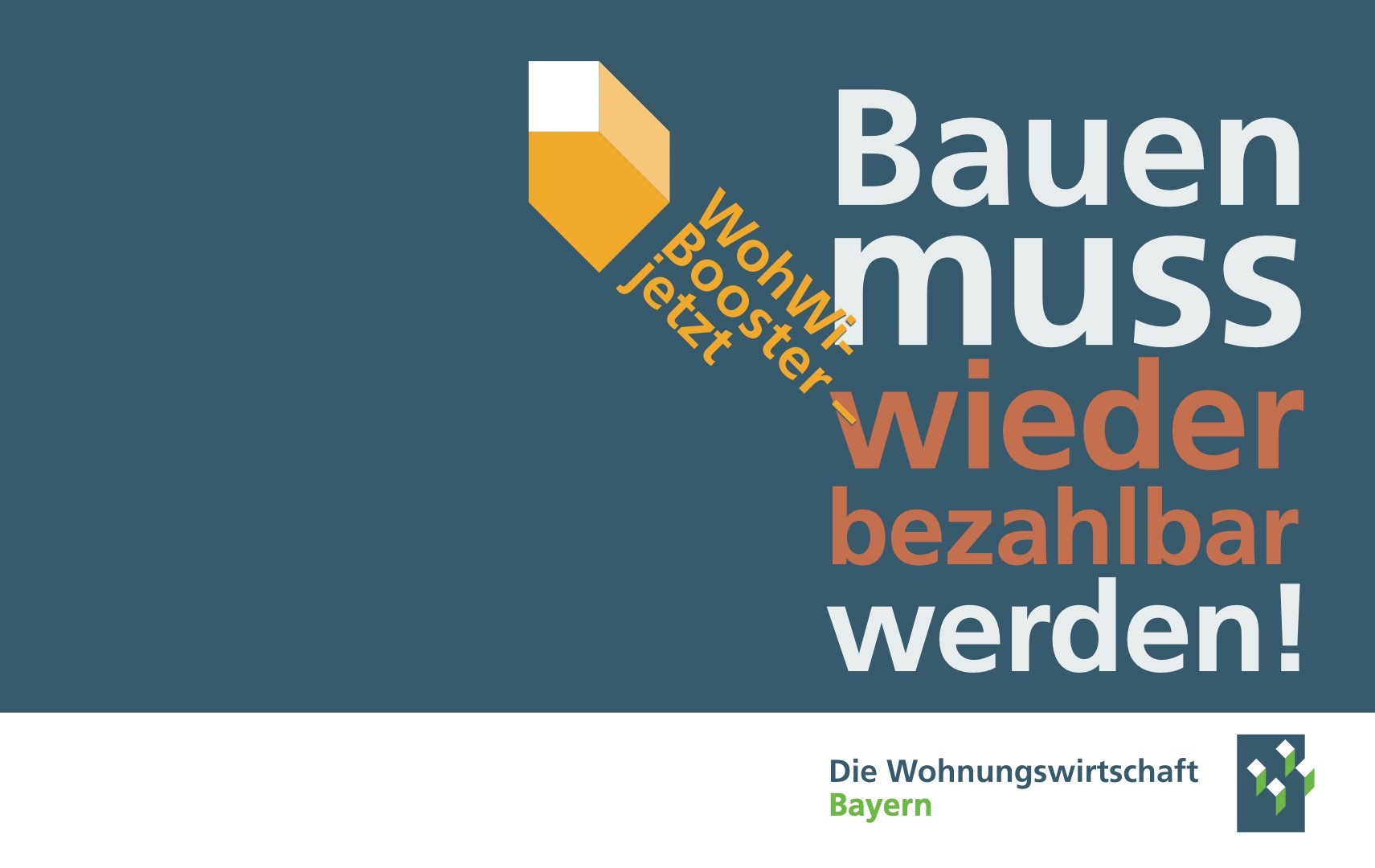Für engagierte Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft, für Mitglieder von Verbandsorganen und Fachgremien sowie für ehrenamtliche Organmitglieder und hauptamtliche Geschäftsführer/Vorstände von Mitgliedsunternehmen hat der VdW Bayern ein Ehrenstatut ausgearbeitet.
Bei den ersten beiden Kategorien (Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft sowie Mitglieder von Verbandsorganen und Fachgremien) werden die Auszeichnungen durch den Gesamtvorstand des VdW Bayern verliehen.
Die Auszeichnungen für ehrenamtliche Organmitglieder und hauptamtliche Geschäftsführer/ Vorstände erfolgen auf Antrag des Mitgliedsunternehmens durch den Verbandsvorstand.
Folgende Auszeichnungen bei Mitgliedsunternehmen sind im Ehrenstatut geregelt:
Für Tätigkeit im Aufsichtsrat / als nebenamtlicher Vorstand eines Mitgliedsunternehmens
Ehrennadel
Für mindestens fünfzehn Jahre nebenamtliche Tätigkeit in Aufsichtsrat / Vorstand
Große Ehrennadel
Für mindestens fünfundzwanzig Jahre nebenamtliche Tätigkeit in Aufsichtsrat / Vorstand
Für hauptamtliche Geschäftsführer / Vorstandsmitglieder
Ehrenring
Für hervorragende Verdienste des hauptamtlichen Geschäftsführers / Vorstandes
Ehrenurkunde
Als Alternative zu Ehrennadel, Große Ehrennadel und Ehrenring
Des Weiteren besteht die Möglichkeit für folgende Ehrungen:
Urkunden für langjährige Mitgliedschaft
Urkunden für Mitarbeiter – Dienstjubiläum
Ihre Ansprechpartnerin beim VdW Bayern für Ehrungen ist Frau
Sonja Schaupp, Tel. 089-290020-308, E-Mail: sonja.schaupp@vdwbayern.de