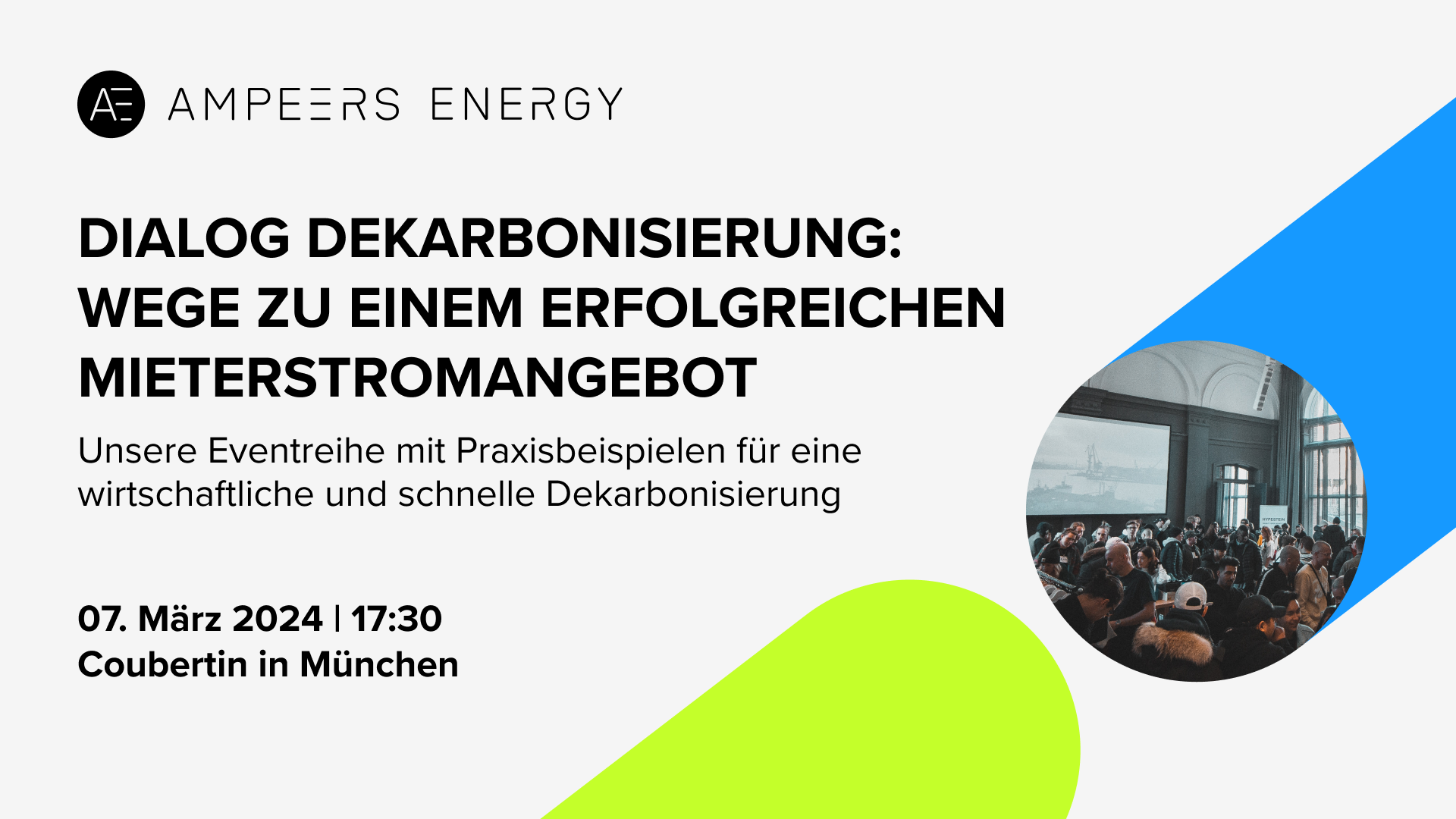KI und Klima“ – das sind derzeit die großen Themen für die Wohnungswirtschaft. Auf der DigiKon Süd 2024, der Digitalisierungstagung für die süddeutsche Wohnungswirtschaft, am 15. und 16. April geht es in Workshops, Vorträgen und Diskussionen um praxistaugliche Digitalisierungslösungen für kleine und große Wohnungsunternehmen.
Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Vorstände und Geschäftsführer, sondern ausdrücklich auch an alle weiteren Mitarbeiter:innen, die Digitalisierung in den Unternehmen ganz konkret gestalten (wollen).
Praxisnaher Einsatz von KI / Digitalisierung unterstützt Klimawende
Die Schwerpunkte der DigiKon Süd 2024 liegen auf praxisnahen Anwendungsmöglichkeiten für KI in Ihrem Wohnungsunternehmen sowie dem Brückenschlag zwischen Digitalisierung und Klimastrategie.
In unseren Vorträgen und im Austausch mit Experten und Praktikern befassen Sie sich unter anderem mit der Frage, welche KI-Lösungen Sie schon heute schnell und effizient in Ihren Arbeitsalltag integrieren können und wie gut Chat- und Telefonbots bei der Mieterkommunikation funktionieren. Darüber hinaus stehen die wichtigsten To-Dos in der Cyber-Sicherheit für Unternehmenslenker und Beschäftigte in der Wohnungswirtschaft, das Aufbrechen von Datensilos und eine Datenstrategie der Zukunft sowie die Frage, wie Sie mittels Digitalisierung die Klimawende in Ihren Beständen und Quartieren unterstützen auf der Agenda der DigiKon Süd 2024.
Workshops
Im Rahmen von praxisnahen Workshops mit Digitalisierungs-Experten wählen Sie selbst aus, in welches Thema Sie tiefer einsteigen und mit Experten sowie anderen Wohnungsunternehmen in die Diskussion kommen wollen:
- KI-Modelle kennen- und einsetzen lernen – im Unternehmen und an Ihrem Arbeitsplatz
- Digitalisierung leicht gemacht – Im Rechnungsworkflow von Papier auf Digital umstellen
- Das nächste Level im digitalen Rechnungs-Workflow – Digitale Rechnungsbearbeitung weiter automatisieren
- Digitalisierung unterstützt Klimawende – Datenerhebung und Datenmanagement für die Dekarbonisierung Ihres Gebäudebestands
Abendveranstaltung & intensives Networking
Um die Eindrücke des ersten Veranstaltungstages gemeinsam Revue passieren lassen zu können und die Vernetzung zwischen süddeutschen Wohnungsunternehmen und Digitalisierungsexperten weiter voranzubringen, laden wir Sie am 15. April zu einer stimmungsvollen Abendveranstaltung ein. Von der Dachterrasse des Restaurants “BellaVista” genießen Sie nicht nur eine Aussicht über ganz Ulm, sondern knüpfen bei leckerem Essen und guten Getränken neue Kontakte, die Sie und Ihr Unternehmen voranbringen.
Alle Informationen zur Veranstaltung, den Workshops sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: https://digikonsued2024.events.vdwbayern.de/
“Digitalisierung praxisnah” für die Wohnungswirtschaft im Süden heißt es am 15. und 16. April 2024 auf der DigiKon Süd 2024 in Ulm – vbw Baden-Württemberg und VdW Bayern freuen sich, wenn Sie dabei sind!